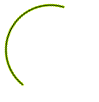Evolution und Anbauform
Ökolandbau fördert die genetische Vielfalt – ist das ein Ansatz für Ertragsoptimierungen?

Mit modernen züchterischen Methoden könnte sich das Wurzelwachstum und der Ertrag von Gerste deutlich steigern lassen. Auch der Ökoanbau würde davon profieren. Symbolbild. (Bildquelle: © Pflanzenforschung.de, erstellt mit DALL·E)
23 Jahre lang hat ein Forschungsteam verglichen, ob sich konventionelle und ökologische Bewirtschaftungsformen darauf auswirken, wie sich die genetische Vielfalt von Gerste entwickelt. Die Genomanalysen geben auch Hinweise, wie Züchter die Ertragslücke im Ökolandbau schließen könnten.
Ist er ein wichtiger Teil der Lösung, um eine wachsende Weltbevölkerung in der Klimakrise zu ernähren, oder nicht? Der Ökolandbau hat eine bessere Klimabilanz als konventionelle Praktiken, er bewahrt besser die Artenvielfalt und belastet Böden und Gewässer weniger. Andererseits zeigen Daten immer wieder: Der Flächenertrag auf ökologisch bewirtschafteten Feldern liegt 20 bis 30 Prozent niedriger als jener auf konventionellen Flächen.
Hochleistungssorten sind nicht an Ökolandbau angepasst
Ein Teil der Erklärung dürfte genetischer Natur sein: Sorten der konventionellen Landwirtschaft wurden über Jahrzehnte auf Leistung optimiert. Zudem sind sie an Agrochemikalien, moderne Managementstrategien und Ernteprozesse adaptiert. Sorten im Ökolandbau beruhen oft auf alten Varietäten. Oder wenn sie speziell für die konventionelle Landwirtschaft gezüchtet wurden, dann sind sie nicht an die Praxis der Ökolandbaus angepasst. Weil diese Hochleistungssorten oft eine gewisse genetische Verarmung aufweisen, gilt als fragwürdig, ob sie als Ausgangsmaterial geeignet wären, um bessere Sorten für den Ökolandbau zu züchten.
Ob und bei welchen Phänotypen unterschiedliche Züchtungsstrategien helfen könnten, ertragsstärkere Sorten für den Ökolandbau zu entwickeln, war bislang mehr oder weniger unklar. Eine Langzeitstudie gibt nun einige wichtige Hinweise: Forscher der Universität Bonn und des Schweizer FiBL haben über 23 Generationen verglichen, wie sich die Anbauweise aufs Genom auswirkt – und welche Hebel sich daraus für die Züchtung ableiten lassen.
Zwei Jahrzehnte natürlicher Anpassung an die Anbauform

Links die konventionelle Population, rechts die Biogerste: Mit dem Auge sind Unterschiede nur für Fachleute erkennbar. Mit Hilfe der Molekulargenetik lassen sich aber große Unterschiede nachweisen.
Bildquelle: © AG Prof. Léon/Uni Bonn
Von 1997 bis 2019 hat das Team eine Kreuzung aus einer Hochleistungsgerste (H. vulgare L. ssp. vulgare) mit einer Wildverwandten (Hordeum vulgare L. ssp. spontaneum) angebaut. Dabei liefen zwei Experimente parallel: Auf einer Fläche wurde die Gerste nach konventionellen Methoden in einer 3-Felder-Rotation kultiviert. Dabei schützen Pestizide die Pflanzen und synthetischer Stickstoffdünger förderte ihr Wachstum. Auf einer Vergleichsfläche haben die Forscher:innen streng nach ökologischen Regeln eine 7-Felder-Rotation angewendet, unter Verzicht auf Pestizide und Wachstumsregulatoren. Düngung erfolgte nur mit Stallmist.
Auf den 9 x 15 Meter großen Flächen wuchsen jährlich jeweils rund 45.000 Gerstenpflanzen. Die folgende Generation wurde ohne weitere Selektion aus dem Saatgut der zentralen Pflanzen erzeugt, um Kontaminationen durch die jeweils anders bewirtschaftete Fläche zu vermeiden. Der einzige Selektionsdruck sollte durch Krankheiten, Nährstoffverfügbarkeiten, Rotationsfolge und Wetterbedingungen entstehen. Letztere erfasste das Team mit Feldsensoren im Zehn-Minuten-Takt: Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Temperatur, Sonneneinstrahlung. Auf diese Weise errechneten die Forscher auch, in welchen Anbauzeiten Wasserdefizite vorlagen.
Konventionell angebaute Gerste verarmte genetisch
Neben den beiden Eltern und der ursprünglichen Kreuzung analysierten die Forscher die Genome der Folgegenerationen für beide Anbaumethoden. Um eine theoretische, unbegrenzte Populationsgröße abzubilden, fasste das Team bei jeder Analyse 300 Genotypen zusammen. Insgesamt identifizierten die Forscher so rund vier Millionen SNPs und über 620.000 Indels. Gut 3,6 Millionen SNPs gelang es zu annotieren und den insgesamt 34.343 Genen der Gerste zuzuordnen.
Während die erste Anbaugeneration noch eine genomweite Allel-Frequenz von 10,07% aufwies, war dieses Maß der genetischen Variation in der letzten Generation des konventionellen Anbaus auf 6,95% geschrumpft. Der ökologische Anbau ging zwar zwischenzeitlich (Generation 12) auch mit einer Allel-Frequenz von 8,96% einher, lag am Ende des Langzeitexperiments jedoch bei 10,57% und damit gut 0,5% höher als in der ersten Anbaugeneration.
Wildform-Allele verbesserten die Anpassungsfähigkeit der Gerste

Das Anbauschema zeigt, wie die Gerste konventionell bzw. ökologisch bewirtschaftet wurde.
Bildquelle: © AG Prof. Léon/Uni Bonn
Anhand von Simulationen konnten die Forscher ausschließen, dass die genetische Drift nennenswert dazu beitragen kann, diese Beobachtung zu erklären. Die Gerste im konventionellen Anbau hatte zudem am Ende des Experiments 3066 Haplotypen der Wildform verloren, wohingegen jene Pflanzen im ökologischen Anbau mit der Zeit lediglich 547 Wildform-Haplotypen verloren hatten. Außerdem ließen sich bei den ökologisch bewirtschafteten Pflanzen erheblich mehr Crossing-Over-Ereignisse nachweisen. Damit liegt nahe, dass die ökologische Anbauform die genetische Variation begünstigt und entsprechend bewirtschaftete Sorten dadurch besser in der Lage sind, sich an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Tatsächlich ist auch genau das im Laufe der Langzeitstudie passiert, wie etwa Abgleiche mit den Wetterbedingungen ergaben.
Weitere Metadatenanalysen erlaubten es, Genomregionen zu identifizieren, die zur größeren Fitness der Pflanzen unter beiden Anbausystemen beigetragen haben. Dabei trugen Allele der wilden Elternpflanze zur biotischen Stressresistenz sowie ertragsrelevanten Merkmalen bei. Nur in der ökologisch angebauten Variante zeigten sich zudem positive Effekte bei Entwicklungsprozessen, abiotischer Stressantwort und vor allem der Wurzelmorphologie. Grund für letzteres könnte die stärker schwankende Nährstoffverfügbarkeit im Ökolandbau sein.
Züchtung für den Ökolandbau sollte auf Wurzelmerkmale fokussieren
Die künftige Sortenentwicklung für den Ökolandbau sollte sich daher vorzugsweise an den besonderen Bedingungen des Ökolandbaus orientieren und sich – so die Empfehlung der Studienautoren – besonders auf wurzelbezogene Merkmale konzentrieren. Nicht zuletzt zeigt die Studie, dass es auch für „konventionelle“ Hochleistungssorten interessant sein kann, ältere Sorten oder Wildformen einzukreuzen – das ist allerdings bereits status quo bei innovativen Forschungsinstitutionen, auch in Deutschland. So kann man zuversichtlich sein, wie auch das Beispiel der Genbank des IPK zeigt. Die Forscher:innen dort analysieren den gesamten „genetischen Schatz“ ihrer riesigen Genbank einschließlich alter Sorten und Wildformen, um sie der modernen Züchtung zuzuführen.
Quelle:
Schneider, M., et al. (2024): „Deep genotyping reveals specific adaptation footprints of conventional and organic farming in barley populations—an evolutionary plant breeding approach“. In: Agronomy for Sustainable Development, 2024, 44:33. doi: 10.1007/s13593-024-00962-8.
Zum Weiterlesen auf Pflanzneforschung.de:
- Was der Ökolandbau für Umwelt und Gesellschaft leistet - Der Thünen Report 65 liefert eine differenzierte Analyse
- Wie sicher ist die Ernte? - Langfristige Ertragsstabilität im Vergleich
-
Mut zu innovativen Züchtungstechniken - Sonst drohen Ertragsverluste durch den „Green Deal“ der EU
Titelbild: Mit modernen züchterischen Methoden könnte sich das Wurzelwachstum und der Ertrag von Gerste deutlich steigern lassen. Auch der Ökoanbau würde davon profieren. Symbolbild. (Bildquelle: © Pflanzenforschung.de, erstellt mit DALL·E)