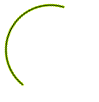Epigenetik
Das Projekt EpicBeet sucht nach epigenetischen Markern für die Zuckerrübenzüchtung

Eine Zuckerrübe im Feld. (Bildquelle: © Tony Heitkam)
Lassen sich epigenetische Merkmale nutzen, um erstrebenswerte Phänotypen züchterisch zu nutzen? Bei Modellpflanzen gibt es darauf Hinweise. Jetzt untersuchen Forscher:innen, ob das Konzept bei Nutzpflanzen tatsächlich anwendbar sein könnte – denn die Erblichkeit von DNA-Methylierungen ist bislang kaum verstanden.
Die Epigenetik ist eines der großen Themen in den Biowissenschaften. Anders als etwa die ähnlich bedeutsame Genomeditierung ist sie jedoch in der Pflanzenzüchtung noch nicht so richtig angekommen – vor allem, weil bis heute nicht einmal klar ist, ob epigenetische Züchtung funktionieren kann. Das Forschungsprojekt EpicBeet soll etwas Licht ins Dunkel bringen.
„DNA-Methylierungen in Nachkommenschaften kann man noch nicht vorhersagen, und daher auch nicht gut danach selektieren“, so beschreibt Dr. Tony Heitkam von der TU Dresden und der Universität Graz ein Problem für die Züchtung. Gemeinsam mit ihrer Arbeitsgruppe an der TU Dresden und Kooperationspartnern von der Universität Bielefeld und des Saatgut-Unternehmens KWS untersucht die Pflanzenforscherin am Beispiel der Zuckerrübe Zusammenhänge zwischen DNA-Methylierung, repetitiver DNA, mobilen genetischen Elementen und deren Weitergabe über Generationen. Denn sicher ist: Epigenetische Modifikationen können ursächlich für auffällige Phänotypen und mangelnde Vererbbarkeit im Züchtungsprozess sein.
Inspiriert von der Ackerschmalwand

Das Genom der Zuckerrübe ist bereits sehr gut erforscht. Hier sind die 18 Chromosomen der Zuckerrübe zu sehen (blaue Färbung). Repetitive DNA-Sequenzen dominieren die Chromosomen und nehmen z.B. die Zentromer-Regionen ein (rote Signale) und kommen auch in großen Bereichen auf den Chromosomen-Armen vor (grüne Signale).
Bildquelle: © Ines Walter
„Die Zuckerrübe ist interessant, weil sie genetisch nicht so divers ist“, erläutert Heitkam. Alle Zuckerrüben gehen auf einen einzigen Kultivar zurück, die um das Jahr 1800 entstandene Weiße Schlesische Rübe. „Es wäre spannend, diesen genetischen Flaschenhals nicht nur erweitern zu können, sondern auch epigenetisch besser zu verstehen“, sagt die Forscherin. Die Voraussetzungen sind gut: Viel Erfahrung mit der Arbeit an Zuckerrüben bringen die Partner mit und für die Kulturpflanze liegt bereits ein detailliertes Referenzgenom vor.
Weitere Starthilfe kommt aus der Forschung an der Ackerschmalwand Arabidopsis thaliana: „Bei Arabidopsis weiß man bereits, dass die Epigenetik großen Einfluss auf repetitive Genombereiche hat“, berichtet Heitkam. Zu diesen gehören auch mobile DNAs, die ihre Position im Genom ändern können. Ändert sich deren Methylierung, kommt es zu einem „Sprung“. Fraglich sei jedoch, wie gut sich die in der Modellpflanze bereits gewonnenen Erkenntnisse auf Nutzpflanzen übertragen lassen. Nicht zuletzt ist die Arbeit an Zuckerrüben zeitaufwendig: Im Gegensatz zur sechswöchigen Generationszeit bei Arabidopsis umspannt der Lebenszyklus der Zuckerrübe zwei Jahre – auch wenn sich der in der Züchtung auf neun Monate beschleunigen lässt.
Die Projektpartner:
TU Dresden - Asst.- Prof. Dr. Tony Heitkam (Projektkoordination)
Universität Bielefeld - Dr. Daniela Holtgräwe
KWS SAAT SE & Co.KGaA - Dr. Britta Schulz
In welchen Genomregionen sind Methylierung besonders stabil?
Das Forschungsprojekt fokussiert sich auf Mutanten mit veränderter Methylierung, die so auch bei Arabidopsis vorkommen: DDM1 und MET1 mit reduziertem Methylierungsgrad sowie MSH1 mit erhöhten Methylierungsgrad.
Zunächst wurden von diesen Pflanzen durch Inzucht reinerbige Linien erzeugt, damit sich die Folgegenerationen nicht genetisch unterscheiden „Es war aber schwieriger als gedacht, homozygote Mutanten zu erzeugen“, berichtet Heitkam von einer schon frühen Hürde. „Viele haben sich als letal herausgestellt.“ Letztlich screenten die Forscher:innen mehr als 12.000 Pflanzen und haben nun 22 DDM1-Linien, 11 von MET1 sowie eine von MSH1. „Aber wir sind schon über die eine Inzuchtlinie von MSH1 sehr glücklich!“, freut sich die Forscherin.
Mobile DNAs von besonderem Interesse – auch wegen der Klimaanpassung

Auf dem Bild sind verschiedene Zuckerrüben-Pflanzen in gleichem Alter zu sehen. Die homozygoten Methylierungsmutanten (Pfeile) sind in ihrem Wuchs deutlich beeinträchtigt.
Bildquelle: © Britta Schulz
Bei diesen Linien will das Team nun untersuchen, wie sich die Methylierung der DNA über mehrere Generationen hinweg verändert und welche mobilen DNAs gesprungen sind. Dazu nutzen die Wissenschaftler:innen sowohl etablierte Methoden wie die Sequenzierung nach Konvertierung methylierter Cytosine als auch die Detektion mit der Nanopore-Longread-Technologie. Diese Daten verbinden die Forscher:innen dann mit morphologischen und zytogenetischen Eigenschaften der Linien. „Im Idealfall haben wir Linien, die genetisch komplett identisch sind, aber im Hintergrund mal eine veränderte DNA-Methylierung hatten“, erläutert Heitkam. „Dann schaut man über mehrere Generationen: Kommt die DNA-Methylierung wieder, bleibt sie so oder ändert sie sich?“
Aus Arabidopsis ist bekannt, dass sich Genomregionen sehr unterschiedlich verhalten: Einige stellen ursprüngliche Methylierungen sehr schnell wieder her, andere gar nicht. Auch deshalb sind repetitive Regionen für die Forschung interessant, denn sie sind häufig unabhängig von der Position im Genom ähnlich methyliert. „Repetitive Regionen sind die Bereiche, die sich am stärksten verändern und generell variabler sind“, ordnet Heitkam ein. Gerade die Anpassung an den Klimawandel könnte in solchen Regionen erfolgen. „Ich persönlich vermute daher eine hohe züchterische Relevanz.“
Erst Longread-Technologien machen Repeat-Analysen möglich
Dass diese Fragestellung erst jetzt untersucht werden kann, liegt auch an Fortschritten in der Methodik: „Mit Longreads haben wir jetzt ein anderes Level erreicht“, betont Heitkam. „Repetitive Regionen auf Longreads kann man genau im Genom lokalisieren und muss nicht sagen: Das kommt 10.000-mal im Genom vor, wo wissen wir nicht.“
Läuft alles nach Plan, könnten künftig unterschiedliche Methylierungen mit züchterisch relevanten phänotypischen Merkmalen korreliert werden. „Wir haben noch keine ausreichende Anzahl von Test-Pflanzen, um eine wirkliche Kausalität zwischen den Merkmalen und den Methylierungsmustern zu zeigen“, weiß die Projektleiterin. „Aber wir können erste Hinweise geben.“
Regionen für ein Epimarker-Screening identifizieren
Bleibt eine mutmaßlich für den Phänotyp entscheidende Methylierung über mindestens sieben Generationen stabil, dann gilt sie als vererbbar und wäre für eine züchterische Selektion relevant. „Wir hoffen, dass wir am Ende des Projekts Regionen vorschlagen können, in denen Methylierungen stabil vererbt werden und es sich lohnt, nach Zusammenhängen mit phänotypischen Merkmalen zu screenen“, resümiert Heitkam. „Das wollen wir dann in einem Folgeprojekt austesten.“
Zum Weiterlesen auf Pflanzenforschung.de:
- Zuckerrübe: Auf der Suche nach der verlorenen Kältetoleranz - Das Projekt „Betahiemis“
- Nachhaltiger Naturkautschuk - Forscher wollen Russischen Löwenzahn züchten, der ohne Vernalisation blüht
- Projekt EpiChrom - Wie lassen sich Gensequenzen in heterochromatischen Bereichen züchterisch zugänglich machen?
- Alternative Schädlingskontrolle - RNA-Spray statt „chemischer Keule“
Titelbild: Eine Zuckerrübe im Feld. (Bildquelle: © Tony Heitkam)